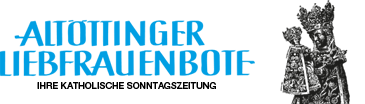Foto: Gerd Altmann auf Pixabay
Foto: Gerd Altmann auf Pixabay
In ihrem Berufsleben als Krankenhaus- und Schulseelsorgerin sowie in der Trauer- und Lebensbegleitung wurde und wird Ingrid Weißl (61) immer wieder mit privaten Schicksalsschlägen konfrontiert. Um in Krisensituationen rasch helfen zu können, gründete die Pastoralreferentin vor 20 Jahren mit einigen Mitstreitern die Notfallseelsorge im Bistum Passau. Ein Gespräch übers Kraft geben und Kraft finden.
 Foto: Roswitha Dorfner
Foto: Roswitha Dorfner
Liebe Frau Weißl, vor 20 Jahren gründeten Sie mit einigen Mitstreitern die Notfallseelsorge (NFS) im Bistum Passau. Was war Ihre Motivation, gab es einen konkreten Anlass?
Weißl: In Altötting passierte vor ca. 20 Jahren ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier junge Männer starben. Kirchlicherseits gab es damals noch keine Notfallnummer, die 24 Stunden erreichbar war. Also brachte ich dieses Anliegen als „Projekt“ bei den Pastoralkonferenzen in Passau ein und gründete die Projektgruppe, bei der aus jeder Region eine Kollegin/ein Kollege (zumeist aus der Klinikseelsorge) eingeladen wurde und wir gemeinsam Ideen zur Konkretisierung sammelten.
Wie haben Sie begonnen und wie hat sich die Notfallseelsorge in den vergangenen Jahren entwickelt?
Weißl: Als Gründungstag wählte ich ganz bewusst den 22.11.2000, den Festtag der hl. Cäcilie. Musik ist eine heilende Kraft und kann wirklich Trost geben und Trauer ausdrücken. „Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden“ sagt Franz Schubert. Um eine Grundausstattung kaufen zu können, wie z.B. Notfallkoffer u.a. haben wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der ev. Kirche „Zum guten Hirten“ in Altötting ein Benefizkonzert veranstaltet. Für jede Region gibt es eine Beauftragte/einen Beauftragten, der die Einsätze koordiniert und die Diensteinteilung macht. Nachdem ich vor 20 Jahren noch vier kleine Kinder hatte, gab ich die Leitung dieser Projektgruppe an meinen Kollegen Dieter Schwibach ab. Er leitet die Notfallseelsorge auch heute noch.
Die Kirche leistet seit jeher in Krisensituationen seelsorglichen Beistand – warum brauchte es dennoch die Organisation der Notfallseelsorge in festen Strukturen?
Weißl: Bedingt durch die vielen organisatorischen Tätigkeiten der Seelsorger in Kirche, Schule und Pfarrei war es wichtig, einen 24-Stunden-Dienst sicherzustellen, damit die Menschen in Not auch einen Menschen (und keinen Anrufbeantworter) am Telefon haben, der sofort kommen kann.
Welche Unterstützung leistet die Notfallseelsorge, wer kann sie beanspruchen und wie werden die Seelsorger informiert?
Weißl: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und andere Hilfsorganisationen benachrichtigen die Notfallseelsorge (NFS), z.B. bei schweren Verkehrsunfällen, häuslichen Notfällen, Suizid, Tod in der Schule, Überbringung von Todesnachrichten … Den Dienst kann jeder in Anspruch nehmen, unabhängig von der Konfession.
Besteht das Team ausschließlich aus ausgebildeten Theologen in Diensten der Diözese – oder werden auch Laien eingebunden?
Weißl: Zu Beginn unserer Tätigkeit waren neben hauptamtlichen Theologinnen/Theologen und Religionspädagoginnen/-pädagogen auch ehrenamtliche Laien mit entsprechender Ausbildung im Einsatz, um den Rund-um-die-Uhr-Dienst zu gewährleisten. (Mittlerweile leisten ausschließlich hauptamtliche Seelsorger Dienst in der NFS, Anm. d. Red.)
 Foto: privat
Foto: privat
Wie gehen die Seelsorger vor, wenn sie zu einem Notfall gerufen werden?
Weißl: Vor 20 Jahren hatten wir von jedem Ort einen Straßenplan besorgt, um zeitnah am Ort des Geschehens zu sein, heute führt uns das Navi hin. Bereits bei der Alarmierung erfährt man, worum es sich handelt und kann sich bereits auf der Fahrt auf die Situation einstellen. Wichtig ist, selbst konzentriert und empathisch zu sein, „einfach da zu sein“ (nicht kompliziert!) und zu helfen, die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen, gegebenenfalls durch ganz praktische Hilfen, z.B. sie in die Klinik zu bringen, um ein Abschiednehmen zu ermöglichen, Ressourcen abzurufen, Verwandte zu benachrichtigen, die helfen können. Dies alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Orts-Seelsorgeteam, damit auch die Begleitung in den ersten Wochen/Monaten danach gut anschließen kann.
„Jeder Seelsorger braucht selbst eine innere Kraftquelle“
Immer wieder werden die Helfer mit äußerst belastenden Situationen konfrontiert. Wie schaffen Sie und Ihre Mitstreiter es selbst, damit umzugehen – und auch noch Kraft geben zu können?
Weißl: Jede Seelsorgerin/jeder Seelsorger braucht eine innere Kraftquelle und die nötige Ruhe und Ausgeglichenheit, wie z.B. auch in der Klinikseelsorge. Ich persönlich habe ein Wort „erfunden“, das mir hilft, bei mir zu bleiben: „Sorgen-Diebstahl vermeiden!“ Nah sein und Hilfe ermöglichen und trotzdem den Betroffenen ihre Sorgen und ihr Leid nicht „stehlen“. Dieser Tipp ist auch für Besuchsdienste hilfreich, damit sie nicht die Sorgen und Probleme der Betroffenen mit nach Hause nehmen. Als ich vor 25 Jahren mit der Klinikseelsorge in Altötting begann, sagte mein damals zehnjähriger Sohn: „Mama, wennst bei jemandem bist, der weit unten ist, dann darfst dich nicht so weit runterbeugen, dass‘d selbst runterfällst, sondern musst ihm ein Seil zuschmeißen, mit dem er sich raufziehen kann“. Unvergesslich – und vermutlich „von oben“ eingegeben.
Auch wenn der Anlass kein schöner war – zum Jubiläum darf man schon einmal fragen: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Notfallseelsorge?
Weißl: Dass immer genügend Kolleginnen und Kollegen da sind, die sich gerne beteiligen – und möglichst wenig Notfälle. Und wenn, dass durch den Einsatz der Notfallseelsorge manches Schicksal etwas gelindert werden kann, weil die Erstversorgung gut gelungen ist und heilsam war.
Interview: Wolfgang Terhörst