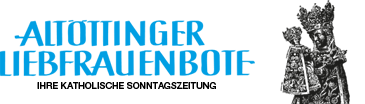Foto: Michael Glaß
Foto: Michael Glaß
Auch das Kennenlernen erfordert Mut und dieser Mut wiederum braucht manchmal mehrere Schritte. Beim Projekt „Miteinander unterwegs: Interreligiöses Friedensgebet Altötting“ führt ein erster Schritt in die Kirche. Jeden ersten Samstag im Monat um 17 Uhr treffen sich in der Altöttinger St. Konradkirche Menschen unterschiedlichen Glaubens, um miteinander zu beten und um anschließend in einen Dialog zu kommen und einander kennenzulernen. Seit fast fünf Jahren gibt es nun diese Initiative. Organisatorin Barbara Heller erklärt dazu: „Jede Mutprobe stärkt – auch deshalb mache ich das.“
Oft ist dir der ein Bruder, den deine Mutter nicht geboren.“ – Wenn es nach diesem arabischen Sprichwort geht, dann gibt es viele Brüder und Schwestern, die sich noch gar nicht kennengelernt haben. Der Imam der muslimischen Gemeinde Alt-Neuötting, Nabil El-Assaad, der dieses Sprichwort gerade zitiert hat, macht den Eindruck, als sei er jederzeit dazu bereit seine „Familie“ um ein paar „Überraschungs-Geschwister“ zu „erweitern“. Beim Dialog im Hof des St. Konradklosters spricht er die Anwesenden freundlich und direkt an und wirft immer wieder mal einen Gedanken ein: „Es gibt eigentlich nur eine Religion: Friede“, sagt er etwa und betont den Wert von Gemeinschaft. Katholische, evangelische und muslimische Gäste haben sich im Juli nach dem Friedensgebet im Klosterhof versammelt und sprechen über das diesmalige Tagesmotto „Versöhnung“. Darunter sind auch Klaus Göpfert, Pfarrer der Altöttinger evangelisch-lutherischen Gemeinde „Zum Guten Hirten“, Kapuzinerpater Br. Marinus Parzinger und Dr. Barbara Heller, Ehe‑, Familien- und Lebensberaterin sowie Organisatorin des Projekts.
 Foto: Michael Glaß
Foto: Michael Glaß
Zuvor hatten – trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie – etwa 35 Gäste in der St. Konradkirche miteinander gebetet und gesungen. Miteinander, nicht gemeinsam! Dieser Unterschied ist wichtig: „Wir treten miteinander vor den einen Gott, auch wenn wir nicht gemeinsam beten“, heißt es in dem Konzept zum Friedensgebet und dies zeigt sich auch klar in dessen Ablauf: ein gemeinsames Lied am Anfang und am Ende; ein klar voneinander getrennter „Zwischenteil“ mit einer christlichen Lesung und muslimischen Koranversen, die sowohl auf Arabisch als auch auf Deutsch vorgetragen werden; ein geistlicher Impuls im „Mittelteil“ sowie vor dem Abschlusslied die Gelegenheit zur Stille oder zu einem freien Gebet.
Für die Katholikin Barbara Heller ist wichtig: „Wir richten uns klar nach den Leitlinien der deutschen Bischöfe und nach den Vorgaben des Papstes.“ In den „Leitlinien für das Gebet bei Treffen von Christen, Juden und Muslimen – Eine Handreichung der deutschen Bischöfe“ heißt es: „Unter Berücksichtigung der bestehenden Schwierigkeiten ist es unumgänglich, diejenige Form der Begegnung zu wählen, bei der die Vertreter der verschiedenen Religionen nicht gemeinsam beten, sondern jeder für sich aus seiner eigenen Tradition heraus spricht. Diese Form entspricht dem beim Weltgebetstreffen in Assisi 1986 praktizierten Modell.“
Sich „im Geist des heiligen Franziskus für Friede und Miteinander einsetzen“
 Foto: Michael Glaß
Foto: Michael Glaß
Organisatorin Barbara Heller erklärt: Es gehe darum, die jeweils andere Religion kennenzulernen und einander im Glauben zu stärken. Das bedeutet vor allem: „Niemand versucht den anderen zu bekehren“, betont sie. Es geht also ganz bewusst um gegenseitiges Verständnis. Einander zu stärken bedeutet freilich auch die jeweiligen Unterschiede zu kennen und zu respektieren, weshalb es eben nicht möglich ist „gemeinsam“ zu beten – zu verschieden sind die Vorstellungen und Lehren von dem einen Gott sowie die Zeremonien und Riten in den drei abrahamitischen Religionen und verschieden sind diese auch in den beiden christlichen Konfessionen. In diesem Sinne ist das interreligiöse Friedensgebet auch kein Ersatz, sondern eine „Ergänzung zur katholischen Eucharistiefeier“, wie es im Konzept dazu heißt.
Bei den Treffen aber ist sowieso das „Praktische viel wichtiger als das Theoretische“, wie Imam El-Assaad auf Nachfrage sagt und allgemeine Zustimmung erntet. Anders ausgedrückt: entscheidend ist nicht die Struktur des Friedensgebets an sich, sondern vielmehr, dass es überhaupt eine offiziell akzeptierte Form des Gebets gibt, damit Gläubige eine Möglichkeit haben sich zu treffen. Für den evangelischen Pfarrer Klaus Göpfert ist es wichtig, „gegen Feindbilder und Vorurteile anzugehen“; er fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir eine Ebene des Gesprächs gefunden haben. Für mich persönlich ist es auch wichtig zum Ausdruck bringen zu können, was einem im Herzen ist – das ist hier möglich!“ Barbara Heller ergänzt: Brücken zu bauen sei „eine der wichtigsten Aufgaben, die wir Christen haben“.
Br. Marinus Parzinger formuliert es so: „Wir wollen Begegnung!“ Für ihn persönlich sei das Friedensgebet „sehr bereichernd“ und für ihn als Kapuziner sei es wichtig, sich „im Geist des hl. Franziskus für Friede und Miteinander einzusetzen“. Erst vergangenes Jahr habe sich das Treffen von Franz von Assisi mit Sultan Al-Kamil in Ägypten zum 800. Mal gejährt, erinnert er – was damals als Bekehrungsversuch gedacht war, endete in einem respektvollen Dialog mitten im Krieg! Eine solche Tradition verpflichtet, auch deshalb passt es sehr gut, dass das Friedensgebet in einer Kirche eines franziskanischen Ordens stattfindet. Br. Marinus fügt hinzu: „Hier gibt es keine Konkurrenz – als Glaubende sind wir doch alle zunächst einmal Suchende“. Darüber hinaus gehe es um die Frage, „wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen: im ‚Jeder gegen Jeden‘ oder im gegenseitigen Respekt füreinander“.
"Die Gottesmutter Maria breitet ihren Schutzmantel viel breiter aus als man denkt"
Dieser Respekt ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, das wissen sowohl Br. Marinus als auch Barbara Heller aus eigener Erfahrung. Beide berichten von vereinzelter negativer Resonanz auf diese und ähnliche Initiativen (wie etwa die Aufnahme muslimischer Flüchtlinge im Altöttinger Kapuzinerkloster). Doch Barbara Heller sieht ablehnende Reaktionen als „zusätzliche Motivation“. Sie erklärt: „Ich mache das, um den Menschen die Angst zu nehmen.“ Schließlich sei meistens die Angst vor dem Fremden der Grund für Ablehnung, und diese Angst kann schnell in den Hintergrund treten, wenn Fremde aufeinander zugehen und sich kennenlernen. Dass sie selbst den Mut dazu fand, diese Initiative ins Leben zu rufen, geht auch auf ihren Glauben zurück: „Die Gottesmutter Maria breitet ihren Schutzmantel viel breiter aus als man denkt“, sagt sie. Zur Entwicklung des Friedensgebets erklärt sie, dass es nach anfänglichem Fremdeln heute „angekommen ist“ in Altötting. Es seien auch schon Wallfahrer gekommen und hätten sich bedankt.
Dies kann Br. Marinus, der erst seit ein paar Monaten wieder in Altötting ist, so zwar noch nicht bestätigen, grundsätzlich erachtet er die Initiative auch mit Blick auf Altötting als Wallfahrtsort für „notwendig“: gerade auch hier „brauchen wir diese Öffnung und Offenheit dem Fremden gegenüber“. Br. Marinus gefällt auch die Gesprächsrunde über Glaubensthemen nach dem Gebet: Diese fänden viel zu selten statt; „das fehlt auch oft nach Gottesdiensten“, sagt er.
Imam Nabil El-Assaad, im Libanon geboren und seit 1961 in Deutschland, antwortet zunächst sehr persönlich: „Ich lebe schon so lange hier und höre immer noch das Wort ‚Ausländer‘ – nicht mehr so oft wie früher, aber es kommt vor“, erzählt er. Die Initiative des Friedensgebets sei für ihn eine „sehr gute Erfahrung“ und er habe den Eindruck, sie gehe „gut voran“.
Homa Azemi ist Vertreterin der jugendlichen Muslime im Organisationsteam des Interreligiösen Friedensgebets. Sie erklärt auf Nachfrage: „Die Begegnung dient zu einem besseren Verständnis und hilft den Menschen, Vorurteile abzubauen und die Unterschiede in der religiösen Praxis und der jeweiligen Kultur besser zu verstehen.“ Schließlich seien alle Teilnehmer „religiöse Menschen“, die im Gespräch nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden suchten, die vor allem aber zeigen wollten „wie die Friedenskraft der Religionen im Miteinander möglich ist“.
 Foto: Michael Glaß
Foto: Michael Glaß
Dazu tragen übrigens auch Veranstaltungen bei, die vor der Corona-Pandemie regelmäßig stattgefunden hatten und – sobald es die Umstände erlauben – wieder stattfinden sollen. Dazu zählen ein bis zweimal im Jahr Vorträge und eine anschließende Diskussion mit prominenten Gästen und theologischen Fachreferenten. Gesellig geht es ansonsten etwa beim monatlichen Brunch in der Gemeinde „Zum Guten Hirten“ zu, wo sich Christen und Muslime in lockerer Atmosphäre austauschen und wo Kinder unter Betreuung basteln und spielen.
So stützt sich das interreligiöse Friedensgebet mittlerweile auf mehrere Pfeiler. Geboren wurde es im November 2015. Als es für eine englischsprachige Eucharistiefeier für christliche Flüchtlinge nach Auflösung einer Neuöttinger Notunterkunft keinen Bedarf mehr gegeben hatte, entwickelte sich damals – maßgeblich vorangetrieben vom mittlerweile nach Spanien berufenen Kapuzinerbruder Jeremias Borgards – die Idee für ein interreligiöses Projekt; auch das Friedensgebet fand anfangs englischsprachig, bald darauf schließlich in deutscher Sprache statt. Von Beginn an mit im Boot waren neben den Kapuzinern und Barbara Heller als Initiatorin und damalige Vertreterin des Pfarrgemeinderats St. Philippus & Jakobus in Altötting der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Ortsgemeinde sowie ein muslimischer Vertreter. Nach wie vor wird das Projekt von katholischen, protestantischen und muslimischen Vertretern getragen. Zu den Sponsoren zählen die Städte Alt- und Neuötting, das Landratsamt Altötting, die Bischöfliche Administration der Kapellstiftung Altötting, die Katholische Erwachsenenbildung Rottal-INN-Salzach, das Dekanat Altötting und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Altötting.
Und was hat es gebracht? „Ich habe gemerkt, wie wenig wir voneinander wissen“, antwortet darauf Pfr. Klaus Göpfert. „Ich habe sehr viel über den Islam gelernt“, erklärt Barbara Heller. „Ich weiß jetzt in theologischen und philosophischen Fragen nicht mehr als zuvor, aber ich sehe meinen eigenen Glauben und verstehe den anderen Glauben besser“, sagt Br. Marinus.
Imam Nabil El-Assaad kommt es ja wie bereits festgestellt sowieso vor allem auf „das Praktische“ an. Dazu gehört an diesem Abend ein Geschenk für den scheidenden, weil in eine andere Gemeinde berufenen evangelischen Pfarrer Klaus Göpfert. Der Imam überreicht ihm eine muslimische Gebetskette, eine sog. Misbaha. Von weitem sieht diese fast aus wie ein Rosenkranz. Pfr. Klaus Göpfert hält sie eher noch ein bisschen ratlos in den Händen. Aber so eine Gebetskette kann halt auch sehr praktisch sein.
Text: Michael Glaß