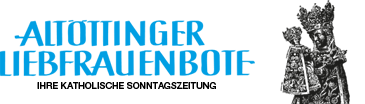Foto: Roswitha Dorfner
Foto: Roswitha Dorfner
Eine eigenartige Lesung wird am Hochfest Mariä Himmelfahrt zum Auftakt des Wortgottesdienstes verkündet, ein Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes. In einer seiner Visionen erblickt der Seher auf Patmos ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Ein Zeichen, das sich nicht leicht entschlüsseln lässt.
 Foto: Roswitha Dorfner
Foto: Roswitha Dorfner
Das Gros der Exegeten meint, man dürfe dieses Zeichen nicht mit Bezug auf Maria deuten, die Geburt ihres Kindes nicht im Hinblick auf die Geburt Jesu, vielmehr sei mit der Frau das jüdische Volk Gottes zur Zeit des Messias gemeint. Wenn dem so ist, warum wurde dann dieser Text in die Liturgie des Hochfestes Mariä Himmelfahrt aufgenommen? Ahnungslos? Wohl kaum, denn man kann diesen biblischen Text in mehrfacher Hinsicht allegorisch lesen und auslegen, und so die verschiedenen Deutungen um eine Variante bereichern. Wenn dem so ist, was sagt uns dann die biblische Perikope?
Dazu findet sich bei einem großen geistlichen Meister des hohen Mittelalters, dem Abt Bernhard von Clairvaux (1090−1153), eine interessante Anregung. In einer Predigt zum Sonntag in der Oktav von Mariä Himmelfahrt – diese Wochenfeier war zu Bernhards Zeiten zumindest bei den marianisch geprägten Zisterziensern üblich – sagt er seinen 200 Mönchen im Herzen der Champagne: „Glaubst du nicht, dass sie (Maria) die mit der Sonne bekleidete Frau ist? Mag sein, dass der Ablauf der prophetischen Vision einen Hinweis darauf gibt, dass dies von der gegenwärtigen Kirche her zu verstehen sei. Trotzdem wird es sicher nicht unpassend scheinen, es auf Maria zu beziehen.“ (Gerhard B. Winkler (Hg.), Bernhard von Clairvaux. Sämtliche Werke. Innsbruck 1990ff. Bd. VIII, 597.) Bernhard kennt also die Deutungsproblematik; und dennoch erkennt er in der Frau nicht das jüdische Gottesvolk, sondern die „gegenwärtige Kirche“ und er erlaubt sich, besagten Passus im Hinblick auf Maria auszulegen. Was sagt nun der Text bei dieser Deutung?
 Foto: Roswitha Dorfner
Foto: Roswitha Dorfner
Die Frau, sprich Maria, ist mit der Sonne bekleidet. Sie steht folglich in strahlendem Licht, von der Kraft und Wärme der Sonne umgeben. Bernhard zieht eine Parallele von Maria und der Sonne zu Mose und dem brennenden Dornbusch, aus dem die Stimme des HERRN sprach, der sich offenbarte als der „Ich bin, der ich bin“. (Ex 3,14) Der brennende Dornbusch wie die glühende Sonne stehen für die Kraft, Macht und Schönheit Gottes. Normalerweise verbrennt ein glühender Dornbusch; normalerweise kann ein Mensch die Kraft der sengenden Sonne in deren unmittelbarer Nähe unmöglich ertragen. „Das vermag keine menschliche Kraft“, so predigt Bernhard, „auch nicht die eines Engels, das vermag nur eine höhere Macht.“ (603) Und so schlägt er eine Brücke zur Verkündigungsgeschichte, in welcher der Engel Gabriel Maria zusagt: „Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.“ (Lk 1.35) Die Sonne symbolisiert die Kraft Gottes. Sie bewirkt als schützendes Kleid Mariens, dass Maria zwar innerlich in Liebe zu Gott brennt, aber nicht verbrennt. Und sie bringt durch Maria ein Kind zur Welt, das heilig ist und Sohn Gottes genannt wird. Diese Sonnenkraft Gottes besagt, dass Maria ganz hell, klar und strahlend rein ist und bleibt. „Ganz weiß doch auch ganz heiß ist das Kleid dieser Frau: Man sieht, dass alles an ihr in so außerordentlicher Weise angestrahlt wird, dass man in ihr – ich sage nicht nur nichts Finsteres –, sondern nicht einmal etwas, was halbdunkel oder weniger hell, und auch nichts, was lau oder nicht glühend heiß ist, vermuten darf.“ (599)
Die Frau trägt aber auch ein Diadem aus zwölf Sternen. Das könnte ein Hinweis auf die zwölf Stämme Israels sein und indirekt auch auf die Kirche, basiert doch die jesuanische Sammlungsbewegung ganz auf den jüdischen Voraussetzungen, weshalb man mit dem früheren Regensburger Neutestamentler Prof. Franz Mußner und mit Papst Johannes Paul II. sagen kann, die Juden seien die „älteren Brüder und Schwestern“ der Christen. Allein aus diesem Grund kann und darf unter Christen niemals Raum für antisemitische Ressentiments sein.
Und was hat es schließlich mit dem Mond auf sich? Für gewöhnlich, so Bernhard, ist der Mond ein Symbol für „Veränderlichkeit“, „für die Torheit des Geistes“. In dieser biblischen Perikope jedoch „für die Kirche dieser Zeit“. (599). Wie der Mond nicht aus sich selbst leuchtet, sondern Kraft des Sonnenglanzes, so kann die Kirche nie aus sich selbst strahlen, sondern nur in und aus der Kraft Gottes. Allein dies sollte die Kirche mahnen, sich nie zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen, sich nicht in endloser Nabelschau zu ergehen, sondern sich ganz dem Glauben an Gott, dem Bekenntnis zu Gott und der daraus resultierenden Sendung zu widmen, erhält sie doch allein von ihm – wie der Mond von der Sonne – ihren Glanz.
Maria ist Mittlerin, Anwältin der Menschen bei Gott
 Foto: Dionys Asenkerschbaumer
Foto: Dionys Asenkerschbaumer
Nun ist von diesem Glanz in unseren Tagen wenig zu bemerken. Ein Grauschleier hat sich über die Kirche gelegt, ja, eine dichte Rauchwolke, wie sie aus Notre Dame und jüngst aus der Kathedrale von Nantes aufstieg. Ist die Kirche am Abfackeln? Löst sie sich in Schall und Rauch auf? Können und dürfen wir diese beiden Rauchzeichen als Mahnung zur Reinigung, von der unser papa em. Benedikt so häufig sprach und dabei auf wenig Verständnis stieß, als Ermutigung zur Erneuerung der Kirche verstehen oder läuten ihre Glocken gar die apokalyptische Endzeit ein, welcher ein gewaltiger Niedergang des Glaubens vorausgehen wird? Technisch sind wir derzeit mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz auf dem besten Weg zur Perfektion; moralisch-ethisch jedoch mit Verlaub so dekadent wie kurz vor dem Untergang des römischen Reiches (Brandrohdung des Regenwaldes, hausgemachte Klimakatastrophe, Betrug als (Abgas-)Methode, Wahrheit als Fake, Umerziehungslager als „Bildungs“anstalten, Kirchenschändungen etc.) Da stellt sich schon die Frage, was man als Christ gegen die aus der Kirche aufsteigenden Nebel- und Rauchschwaden tun kann. Darauf weiß Bernhard eine Antwort: Er verweist uns auf eine Frau aus dem Löschzug der „himmlischen Feierwehr“, die diesen Brand zu löschen vermag.
In besagter Predigt beleuchtet er einen bedenkenswerten Aspekt. In der Vision des Johannes, so Bernhard, steht die Frau, sprich Maria, zwischen Sonne und Mond, d.h. zwischen Gott und der Kirche. Dies verweist uns auf die Mittlerschaft Mariens. Offensichtlich gefiel es Gott, sie nicht nur zur Mutter seines Sohnes zu erwählen, sondern auch zur (Ver-)Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Und genau deshalb sieht die Kirche Maria als die große Frauengestalt; und genau deshalb wallfahren seit Jahrhunderten Menschen zu Orten, an denen Maria verehrt wird.
Der kürzlich verstorbene Heidelberger Neutestamentler Prof. Klaus Berger erachtet die Doppeldeutung der Frau im Hinblick auf Maria wie auf die Kirche für legitim. „In Maria ‚verdichtet‘ sich das ganze Volk.“ „Alles, was von Maria gesagt sei, gelte auch von der Kirche und umgekehrt.“ Davon, so Berger, waren selbst die Reformatoren überzeugt. „Bei der mariologischen Deutung des Gottesvolkes stellt Maria dieses Volk nicht lediglich symbolisch dar, sondern wirklich. Der Gedanke der Schutzmantel-Madonna bringt das gut zum Ausdruck: alle die vielen Christen unter einem Mantel. Maria ist die Kirche.“ Unser Foto zeigt eine steinerne Schutzmantelmadonna aus der Pfarrei Ering am Inn, datiert auf das Jahr 1441. Nebst dem Stifterpaar am unteren Bildrand finden alle damals bekannten Stände – Adel, Klerus, Volk – unter ihrem Mantel Schutz und Schirm. In diesem Sinne ist Maria die Kirche. Das sagt übrigens der Passauer Bischof Stefan Oster immer wieder; und so, wie dies Bernhard von Clairvaux und der Bernhard-Kenner Klaus Berger beschreiben, wird es verständlich(er): In Maria „verdichtet“, „komprimiert“ sich Kirche. (Klaus Berger, Kommentar zum neuen Testament. Gütersloh 2011, 1026)
Weil sie Mittlerin ist, Anwältin der Menschen bei Gott, empfiehlt Bernhard seinen Mönchen und uns, zu Maria zu rufen, sie anzurufen und als wichtige Fürsprecherin bei Gott zu erkennen. Der aus dem Adel stammende Bernhard empfiehlt daher seinen Mönchen im 12. Jahrhundert und uns heute in höfischem Sprachfall: „Umfangen wir die Füße Mariens, meine Brüder (und Schwestern), und werfen wir uns mit demütigen Bitten vor ihren seligen Füßen nieder. Halten wir sie fest und lassen wir sie nicht los, bis sie uns gesegnet hat: Sie hat nämlich die Macht dazu.“ (601).
Text: Domvikar Msgr. Bernhard Kirchgessner
 Foto: Roswitha Dorfner
Foto: Roswitha Dorfner